|
|
|
|
|
|
||||||
|
Bernd Strauch | Heimatseiten Oberhessisch - Dialektwörterbuch |
Häi sein ech dehém: www.oberhessisch.com |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Seite als PDF |
Vorherige Seite | Nächste Seite |
|
||||||||
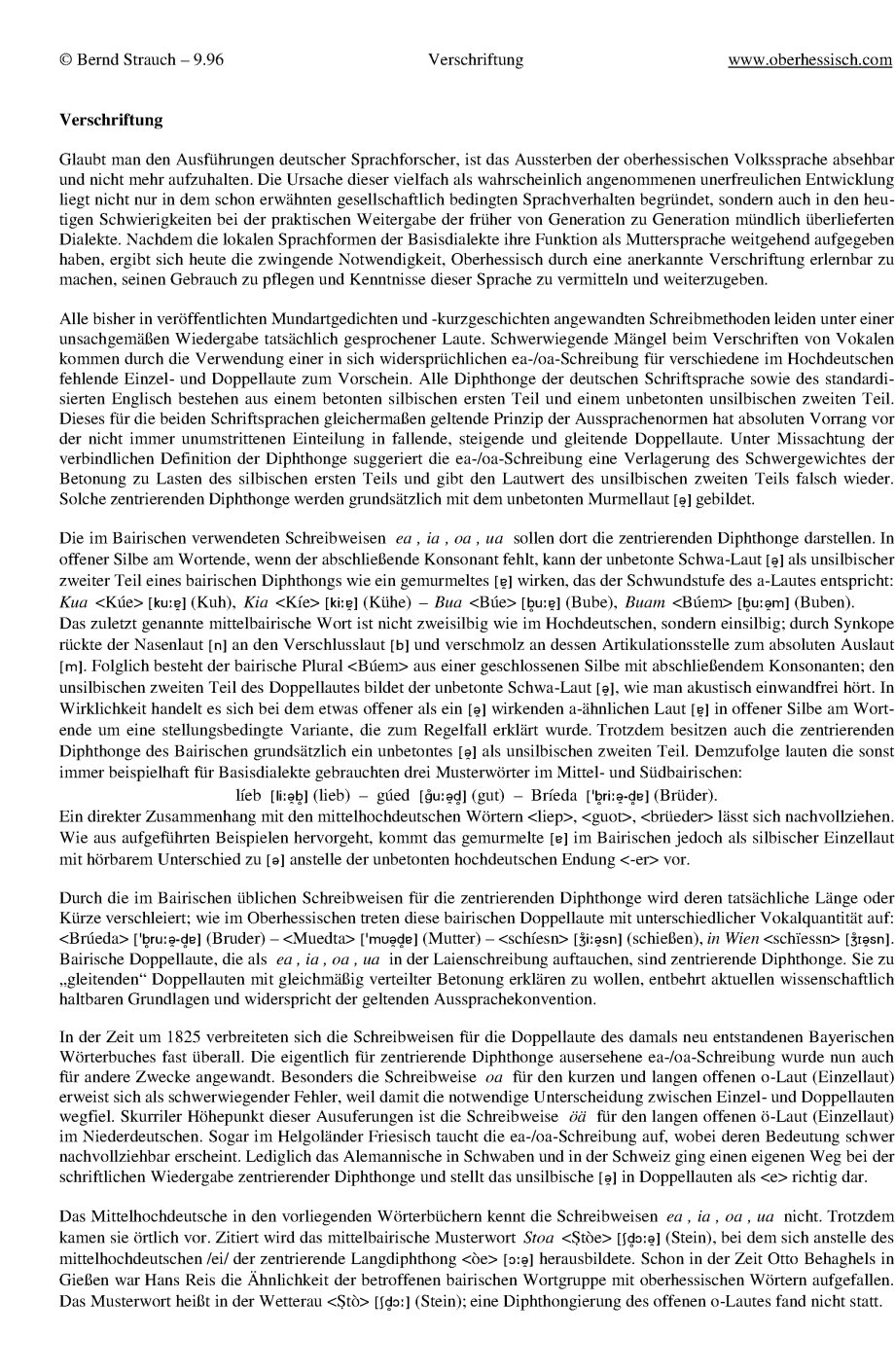 |
Verschriftung Wissenschaftliche Arbeiten aus der Zeit um 1927 (Wetterfelder Wörterbuch im 20. Gießener Beitrag zur dt. Philologie) sowie von 1973 und 1980 (Dt. Dialekt-geografie Marburg) weisen nach, dass im Zentralhessischen kurze und lange Doppellaute auftreten. Das sind starke steigende Diphthonge mit unsilbischem i- oder u-Laut als unbetontem 2. Teil, aber auch zentrierende Diphthonge mit unsilbischem Schwa-Laut. Quantitative Unterschiede bei diesen Doppellauten müssen in der Dialektschreibung laut-schriftlich wiedergegeben werden. Da die im zentralhess. Großdialekt vor-kommenden Diphthonge akustisch den englischen ähneln, erscheinen diese in der lautschriftlichen Dialektschreibung. Dafür eignet sich nur eine phonetisch orientierte schriftliche Darstellung, die mit dem Schreibsystem der deutschen Schriftsprache einhergeht. Bereits vor einem Jahrhundert erfolgte die Eindeutschung der zwei englischen Begriffe „cakes“ und „cokes“. Jeweils in den Wörtern vorhandene Doppellaute konnten nicht bestehen bleiben, da sie in der deutschen Schriftsprache fehlen. Hätten oberhessische Diphthonge Ver-wendung gefunden, wäre die damalige Übernahme lautlich korrekt geworden: <Käiks> (Keks), <Kouks> (Koks). Die zentrierenden Diphthonge können im Bairischen 3 unterschiedliche Vokal- quantitäten besitzen: vokalische Länge aus langem und kurzem Laut, 2 kurze Laute als vokalische Länge, vokalische Kürze aus 2 Lauten. Sichtbar wird dies durch 3 quantitative Möglichkeiten zur Aussprache des Wortes für „schießen“: <schíesn>, <schiesn>, <schïessn>. Mancherorts kommt anstelle von <íe> der nach einer Absenkung des i-Lautes entstandene lange bairische Diphthong <ée> vor: <Wéena> (Wiener). Ein Festhalten an Schmellers Definition der zentrierenden Diphthonge mit dem a-Laut an unsilbischer 2. Stelle in neu-artigen Sprachatlanten erweist sich als verhängnisvoll. Die Mundartschreibung „ea, ia, oa, ua“ wird beim praktischen Anwenden sanktioniert, obwohl solche Schreibweisen deutschen Rechtschreib-gewohnheiten zuwiderlaufen. Weiterhin betrifft es auch die Lesegewohnheiten, weil derartige Schreibweisen mit einem a als zweitem Teil schwacher Doppel- laute im Hinblick auf eine reibungslose Aussprache irreführend sind. Vor allem die interessierten Leser unter den Neu-einsteigern dürften ihre Mühe haben. Hinzu kommt die Tatsache, dass nach wie vor die Schwundstufe des a-Lautes als Einzellaut in unbetonten bairischen Endungen auftritt und somit im Schrift-bild von Mundarttexten erscheint. Die von Johann Andreas Schmeller an-gewandten Buchstaben-Kombinationen „ea, ia, oa, ua“ für schwache bairische Doppellaute kamen in seiner Zeit der tatsächlichen Aussprache offensichtlich relativ nahe. Unbefangene Zuhörer aus Sprachlandschaften außerhalb Bayerns nehmen heutzutage einen Schwa-Laut an unbetonter 2. Stelle der schwachen bairischen Doppellaute wahr, vor allem bei Dialektwörtern mit geschlossener Silbe. Aus diesem Grunde ist nicht von der Hand zu weisen, dass irgendwann eine sprachliche Entwicklung begann, die einen unsilbischen Schwa-Laut als unbetonten 2. Teil dieser zentrierenden Diphthonge entstehen ließ. Demzufolge verwandelte sich die Schwundstufe des a-Lautes durch Abschwächung in einen Schwa-Laut, der als Schwundstufe der e-Laute gilt. Bei der Verschmelzung des Verschluss-lautes [b] mit dem Nasenlaut [n] blieb ein Glottalstopp vor dem entstandenen [m] im Bairischen als Rest der Silben-grenze ursprünglich zweisilbiger Wörter übrig: /le:’m/ (leben). Diese örtlich an-zutreffende lautliche Besonderheit fehlt im vergleichbaren hochdeutschen Wort /le:m/ (Lehm). Auf Seite 8.89 befinden sich Angaben zum hess. Glottalstopp. Während das Oberhess. keine Synkope kennt, können aber im Neuhessischen einzelne assimilierte Formen auftreten, bei denen eine Verschmelzung benach-barter Konsonanten stattfand: <Àmd> (Abend), <hamme> (haben wir). Die letzte Wortbildung ist nur möglich, da das unbetonte Personalpronomen neu-hessisch <me> (wir) lautet. |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
Vorherige Seite | Nächste Seite |
Startseite |
|
||||||||
|
Impressum | Datenschutzerklärung | webdesign by csle |
www.oberhessisch.com weiterempfehlen |
|
||||||||